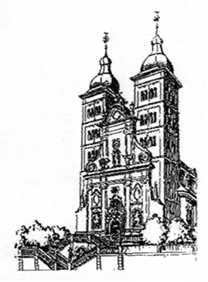In einem festlichen Abendmahlsgottesdienst in der fürstlichen Abteikirche sprach die ehemalige evangelische Pfarrerin Marie Sunder- Plassmann über die sakrale Kunst in der Barockzeit.
Nach dem 30jährigen Krieg und nach der Schwächung der Kirche durch die Konfessionstrennung brauchten die Gläubigen eine neue Vision. Hundert Jahre vorher wurden die Menschen zu sozialem Verhalten gezwungen, indem ihnen Angst vor dem Fegefeuer gemacht wurde. Im Barock wurde ihnen als Belohnung von guten Taten das Paradies in Aussicht gestellt. Und den Vorgeschmack darauf erlebten sie in der Musik, der Poesie und der Ausstattung der barocken Kirchen.
Das Ehepaar Sunder-Plassmann wohnt jetzt am Ammersee, und dort war in der Barockzeit die in ganz Europa berühmte Schule der Wessobrunner Stuckateure angesiedelt. Nachdem zwei der fähigsten Stuckateure, Johann Übelhör und Johann Feichtmeir das Marienmünster in Diessen am Ammersee ausgestattet hatten, kamen sie nach Amorbach und zauberten in das neue Licht des barocken Kirchenumbaus ihr Rankenwerk und ihre Muschelzier, ihre Puttenscharen und Blütenkette, um das Göttliche zu verherrlichen und das Jenseits sichtbar zu machen.
Paul Gerhardt, schon 80 Jahre vorher, aber seiner Zeit weit voraus, brachte mit seiner Poesie den protestantischen Gemeinden, die in der Ausstattung ihrer Kirchen viel zurückhaltender waren, eine ähnliche Vision.
Gerade in seinem beliebten Lied "Geh aus mein Herz und suche Freud" ist das gut zu finden, wenn man alle 15 Strophen in den Blick nimmt.
Die Schola der Abteikirche und die zahlreich erschienenen GottesdienstbesucherInnen sangen im Wechsel alle Strophen.
Die Pfarrerin erklärte die Dreiteilung des Liedes: In den ersten 7 Strophen lobt Paul Gerhardt den Schöpfer, indem er die Freuden der Sommerzeit benennt. Die Schönheit der Blumen und Bäume, die Anmut der wilden Tiere, den feinen Vogelgesang. Auch die bäuerlichen Bilder der Glucke, der Schafe, der Bienen oder des Weizens nutzt Paul Gerhardt, um Wohlgefühl zu dichten. Dann kommt, in der Mitte des Liedes die berühmte Strophe: " Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinne."
Und nun folgert der Liederdichter in den nächsten Strophen: wenn es schon auf Erden so schön ist, wie schön muss es dann erst in "Christi Garten" sein, im Paradies, und er malt verführerische Jenseitsbilder.
Aber damit endet das Lied nicht. Nicht: " Alles wird gut", sondern: weil alles gut wird, können wir hier in unserem manchmal ( in Paul Gerhardts Leben immer) schweren Erdenleben mit Gottes Hilfe eine " schöne Blum" und " ein guter Baum" werden, also Menschen, die aufrichtig und fleißig, hilfsbereit und guten Herzens sind.
Mit der Predigt brachte die ehemalige Pfarrerin auch ihre bleibende Verbindung mit Amorbach, in dem Fall durch die oberbayerischen Stuckateure, zum Ausdruck.